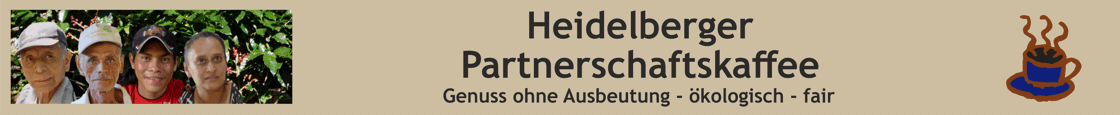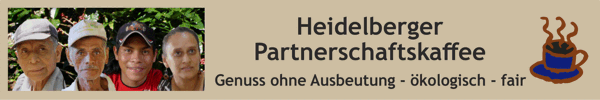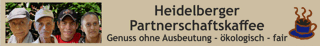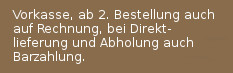Buen Vivir - Gut leben mit und vom Kaffee?
Es ist bekanntlich ein wichtiges Mittel der Werbung, Stichworte für sich bzw. seine Produkte zu vereinnahmen. So hat auch der Faire Handel den Begriff „Buen Vivir“ für sich entdeckt und reklamiert ihn an verschiedenen Stellen für Kaffees aus Lateinamerika. Das Bild vom Buen Vivir als „Gutes Leben“ der Produzenten im Einklang mit der Natur passt auch schön zur Selbstdarstellung des Fairen Handels. Aber hat die kleinbäuerliche Kaffeeproduktion etwas mit der Realisierung von Buen Vivir zu tun? Hat der Begriff einen realen Bezug zum Kaffeehandel des Heidelberger Partnerschaftskaffee?
Eigentlich ist die grundlegende Frage noch nicht beantwortet, wer mit und vom Kaffee gut lebt. Sind die Landarbeiter gemeint, die Kleinbauern, die Exporteure, die Hersteller teurer Kaffeemaschinen oder gar wir Konsumenten? Buen Vivir klingt erst mal nach den Produzenten. Aber die statistischen Zahlen sagen etwas anderes (siehe Info-Grafik), vor allem die Konsumenten in Industrieländern wie Deutschland leben gut mit dem Kaffee und profitieren  vom dauerhaften Verfall der Rohstoff- und Verarbeitungspreise. Und unser wachstumsorientiertes Wirtschaftsmodell schafft mit dem beim Rohstoff Kaffee eingesparten Geld einen neuen Markt für teure Kaffeemaschinen – die natürlich nicht von Kaffeebauern hergestellt werden.
vom dauerhaften Verfall der Rohstoff- und Verarbeitungspreise. Und unser wachstumsorientiertes Wirtschaftsmodell schafft mit dem beim Rohstoff Kaffee eingesparten Geld einen neuen Markt für teure Kaffeemaschinen – die natürlich nicht von Kaffeebauern hergestellt werden.
Was ist damit gemeint, wenn von Buen Vivir und Kaffeebauern geredet und geschrieben wird? Die Antwort darauf ist vielschichtig. Einerseits verbietet es sich, die bestehenden Lebensbedingungen der Produzenten mit der wörtlichen Übersetzung als „Gutes Leben“ zu bezeichnen, denn meist können die Kleinbauern mit wenig Land selbst beim sog. Fairen Handel nur gerade so die Grundbedürfnisse ihrer Familie befriedigen. Der Begriff kann höchstens zur Perspektiv- oder Zielbeschreibung verwendet werden.
Andererseits sind wesentliche Elemente des Buen Vivir eine gesellschaftliche Reaktion auf die negativen Auswirkungen der neoliberalen Politik. Ähnliche Elemente gehören aber auch zu den Idealen einer guten Kooperative, die schon immer als ein Element der Selbstorganisation und gegenseitigen Absicherung der benachteiligten Bevölkerung dienten.
Buen Vivir entspricht nicht den europäischen und kapitalistischen Kategorien wie Moderne, Fortschritt, Wachstum und Entwicklung. Es beruht auf anderen historische Erfahrungen: In einem Land wie Nicaragua weiß eine Mehrheit der Bevölkerung, dass Projekte im Namen des Fortschritts und der Entwicklung, wie zum Beispiel der Aufbau großer agroindustrieller Betriebe, oft dazu führen, dass Bauernfamilien ihr Land und ihre soziale Sicherheit verlieren, die natürlichen Ressourcen stärker ausgebeutet und geschädigt werden.
Das heißt aber nicht, dass Kooperativen auf dem Status Quo beharren würden oder technologiefeindlich wären. Ganz und gar nicht. Aber es geht ihnen nicht um Wachstum als Selbstzweck bzw. zur Gewinnmaximierung, sondern um die Frage, wer warum was benötigt. Bei solchen Entscheidungen haben Kooperativen alleine schon aufgrund ihrer Organisationsstruktur und der Ausrichtung an den Bedürfnissen ihrer Mitglieder einen ökologischen und sozialen Vorsprung vor vielen anderen Unternehmensformen. Agrarkooperativen denken aus der Sicht der regionalen Gemeinschaft und beziehen aufgrund ihrer relativ direkten Abhängigkeit die Auswirkungen auf Natur und Umwelt stärker in ihre Entscheidungen ein. Die meisten Anstrengungen der Kooperativen richten sich derzeit auf die Stabilisierung der Einkommenssituation von kleinbäuerlichen Familien. Dabei geht es um eine bessere Ausbildung der Mitglieder, um die Diversifizierung der Produktion, die Versorgung mit einem geeigneten Biodünger und den Aufbau von eigenen Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen. Damit die Kleinbauern zusätzliches Land erwerben und ihren Anbau erweitern können, werden sie von ihren Kooperativen mit Krediten unterstützt.
Die meisten Anstrengungen der Kooperativen richten sich derzeit auf die Stabilisierung der Einkommenssituation von kleinbäuerlichen Familien. Dabei geht es um eine bessere Ausbildung der Mitglieder, um die Diversifizierung der Produktion, die Versorgung mit einem geeigneten Biodünger und den Aufbau von eigenen Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen. Damit die Kleinbauern zusätzliches Land erwerben und ihren Anbau erweitern können, werden sie von ihren Kooperativen mit Krediten unterstützt.
Die Erweiterung des Bioanbaus für einen besseren Umweltschutz hat durch die Pilzerkrankung vieler Kaffeepflanzen (Roja) einen herben Rückschlag erlitten. Den Bauern in Kooperativen, die schon immer nur biologisch produziert hatten, gelingt es widerspruchsfreier, auch in Zeiten extremer Belastung durch Pflanzenkrankheiten zur Bioproduktion zu stehen. Aber in Kooperativen, in denen nur ein Teil der Bauern biologisch produziert, ist es aktuell schwierig, neue Bauern für den Bioanbau zu gewinnen.
Eine wesentliche Schwäche bei der Konstruktion eines Zusammenhangs zwischen FairTrade und Buen Vivir liegt in der Gestaltung der als Fair bezeichneten Preise. Auch beim Fairen Handel sind die Produzenten seit Jahren die Verlierer. Die von der Lateinamerikanischen Koordination des Fairen Handels (CLAC) geforderten höheren Mindestpreise – eine bessere Grundabsicherung in Zeiten niedriger Weltmarktpreise – möchten bisher nur wenige Handelsorganisationen zahlen. Mit dem Projektaufschlag von 1 Euro pro kg verkauftem Kaffee für die direkten Anliegen der Kooperativen unterscheidet sich der Partnerschaftskaffee hier wesentlich von anderen Fairtrade-Händlern.
Die Anliegen hinter dem Buen Vivir – Konzept spielen auch für den Partnerschaftskaffee eine wichtige Rolle. Aber weil der Begriff relativ ungenau ist und vielfach als eine Imagination zu Stichworten wie 'Nachhaltig', 'Fair' und 'Glückliches Landleben' missbraucht wird, halten wir ihn bei der Darstellung der Arbeit unserer Partner-Kooperativen nicht für besonders hilfreich. Wir reden lieber von der Partizipation der Mitglieder bei den wichtigen Entscheidungen, von der materiellen Unterstützung und Beratung der Bauern, von der Diversifizierung des Anbaus, von Anstrengungen für die Ausbildung und Förderung von Jugendlichen, Projekten für … In dieser Konkretisierung können sich unsere Kunden deutlich mehr unter der konkreten Arbeit vorstellen. (rk)

Die dünnen Monate
In der Zeit nach der Kaffeeernte, wenn die Bezahlung des Kaffees fast aufgebraucht und die erwartete Vorfinanzierung des fairen Handels für die nächste Ernte noch nicht angekommen ist, geht in kleinbäuerlichen Familien immer wieder das Geld aus. Deshalb wird diese Zeit auch als die „dünnen Monate“ bezeichnet. In den letzten Jahren besserte sich durch verschiedene Ernährungsprogramme die Situation in Nicaragua deutlich, die Gefahr des jährlich wiederkehrenden Hungers ist gesunken. Dennoch:
Fast 50% der Bevölkerung Nicaraguas lebt auch heute in ländlichen Gebieten und der Lebensunterhalt von 80% dieser Menschen hängt direkt oder indirekt von der Landwirtschaft ab (IFAD, 2013). Die meisten ländlichen Haushalte sind vom Anbau weniger Kulturpflanzen (Sorghum, Mais, Bohnen, Kaffee) abhängig und anfällig für Marktschwankungen und extremer Witterungsverhältnisse. Die aktuell verheerende Erkrankung der Kaffeepflanzen durch die 'Roja' ist u.a. durch die schwierigen Witterungsverhältnisse aufgrund des weltweiten Klimawandels entstanden.